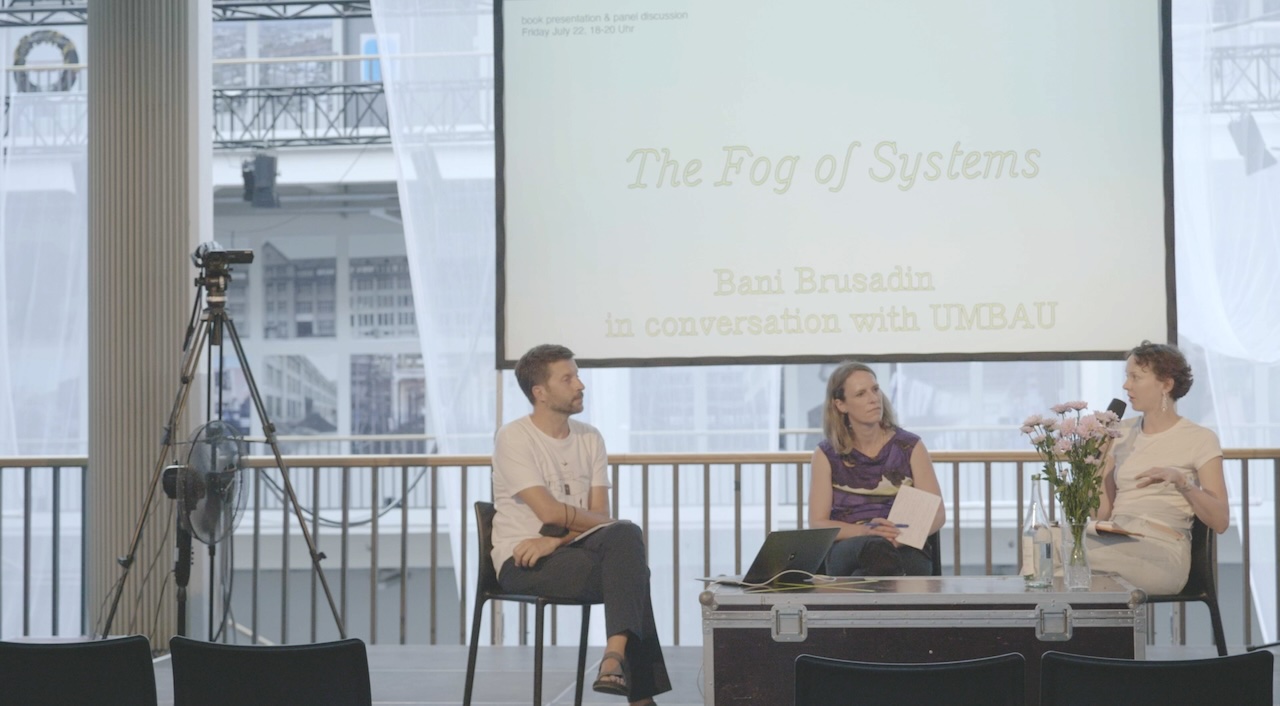
Teaching
- Global Flows
- Remnants
- Post-Readymade. Found Objects in Art, 1960 Until Today
- Objects – Bodies – Matter
- How to Make Sense of an Empty Gallery Space
- Sur-real
- How to Write about Contemporary Art
- Post-Internet. Ein Gegenwartstrend im Kontext der Medienkunst-Geschichte
Since 2013, Katharina has been teaching seminars on modern and contemporary art at HfG Karlsruhe, UdK Berlin, Konstanz University and Bauhaus University Weimar. In gathering hands-on experiences in the art market, artist studios and museums, she gained an inside perspective on the real-life conditions that shape artistic practices. These experiences have greatly influenced her teaching practice, in which she conveys a critical understanding of what we call ‘art’ (and which practices, places, media and communities this term excludes). In her seminars, Katharina situates art’s shifting ideologies and practices in historical context, shedding light on the various economic and institutional conditions that inform them. Despite its problematic entanglements, she believes that art provides a much needed, semi-autonomous space for reflection on the technological and sociopolitical environments that immerse us.
Her students are BA and MA students from the fields of art, design, art history and media philosophy. Her seminars are debate-oriented and often result in creative outputs such as booklets, exhibition contributions and public interventions. One of her favorite seminar outputs was “The Pillow Book” edited by Jeongmin Han and George MacBeth, developed in the seminar “Post-Readymade”. The seminar had discussed forms of object appropriation that go against the grain of Duchamp’s Readymades: Drifting objects that set off artistic processes without necessarily entering into a gallery space. The student group came up with a poetic guerilla intervention into Deutsche Bahn’s ICE trains. They placed cards with an ominous QR code under the blue pillows that are the standard head rests in these prestigious highspeed trains. The code led to a book of texts inspired by the pillow. Read “The Pillow Book” (PDF).
Global Flows
Remaining largely invisible from a local perspective, the global ‘flows’ our daily lives depend on have a way of coming into focus when interrupted: When super market shelves remained empty in 2020; when a cargo ship got stranded in the highly trafficked Suez Canal in 2021; this year, as the Nord Stream pipeline may stop delivering gas to Europe; or whenever a single undersea cable (which the Internet relies on) is cut. One artist who rendered sites and processes visible, through which our world is connected, was Allan Sekula. Sekula’s photo essay “Fish Story” (1989-1995) was an exploration of the ocean as a pivotal space of globalization – and a critical examination of documentary photography’s representational politics. “Fish Story” shed light on the connection between containerized cargo movement and the growing internationalization of the world economy. In 2022, stress on supply chains is going hand in hand with a humanitarian challenge, as Russia’s invasion of Ukraine has triggered one of the largest and fastest refugee movements in Europe since World War II. Considering investigative artistic practices of the past 30 years, this seminar examines how art has been mapping, tracing, and exposing global flows of people, goods, matter and information in a shifting global environment.
Remnants
Wenn in Deutschland Baustellen ausgehoben werden, dann findet man vor allem eines: Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Seminar geht es um Bomben und Tretmienen, Ruinen und Fundstücke. Untief unter dem Asphalt unserer Straßen liegende Weltkriegs-Überreste mögen uns noch lange heimsuchen (es wird derzeit von etwa 100.000 unentdeckten Blindgängern ausgegangen). Doch liegt im Verdrängten, Unentschärften, Uneingelösten auch ein explosives epistemisches Potential: Es vermag herrschende Narrative (Gesellschaftsmodelle und Identitätskonzepte) aufzubrechen und alternative Geschichten zu erzählen. Genauso aber kann eine typisch ‚sublime‘ Ruinen-Ästhetik als Hollywood-Spektakel auch den kulturellen Status Quo verfestigen. “Remnants“ nimmt ausgewählte Positionen der Kunst seit 1990 zum Ausgangspunkt, die mit ihren pseudo-/wissenschaftlichen Arbeitsweisen den Weg für das bereitet haben, was in jüngster Zeit als ‚Artistic Research‘ disziplinär neu verankert wird: Kunst adaptiert Verfahren der Feldforschung und Dokumentation, der Archäologie und Forensik – und konterkariert diese mitunter zugleich. Spurensuche wird zum Road Trip, wird zur Odyssee…
Post-Readymade. Found Objects in Art, 1960 Until Today
In his first MoMA show Gabriel Orozco did something unusual: He avoided the prestigious museum’s exhibition spaces. Objects and photographs were loosely scattered in staircases and hallways. One work, however, was nowhere to spot. In order to find “Home Run”, visitors had to look out the window at the façade across the street: Once you detected one orange in the building’s windows, you suddenly saw them everywhere. Did “Home Run” transform a banal thing into an ‘objet d’art’ outside the walls of the museum? Since its introduction into the art discourse around 1960, Duchamp’s concept of the ‘Readymade’ has undergone various transformations. Yet, the term persists in art history to frame any art practice which appropriates objects from ‘real life’, even if they break with Duchamp in every other way: Objects leave the museum, enter economic flows as subversively modified Coca-Cola bottles (Cildo Meireles), or simply dissolve in the mouths of museum visitors (Félix González-Torres). In 1996 Jimmie Durham stoned a refrigerator, and just recently Mark Leckey gave a Smart Refrigerator a godlike voice. Is there a connection? This seminar will look at art forms using found objects in order to shed light on the (capitalist, racist) economic and social systems we inhabit – ranging from Nouveau Réalisme, Fluxus, Institutional Critique, to Relational Aesthetics, activist and postdigital art. Emerging from such movements, ‘Post-Readymades’ (my neologism) might function as new epistemic objects.
Objects – Bodies – Matter
Shape Shifters, Vibrant Matter, animierte Objekte, verdinglichte Körper? Den Ausgangspunkt dieses Seminars bildet die Einführung in einen aktuellen Diskurstrend: ‚New Materialism’. Was passiert, wenn unser Verhältnis zu Materialität und Dinglichkeit instabil wird? Heute schwankt unsere Erfahrung der Objektwelt zwischen Atrophie (Digitalisierung) und Hypertrophie (Massenproduktion, Vermüllung). Letzteres Paradigma prägte die Kunst der 1960er: Zelebrierte die Pop Art den Überfluss der Konsumkultur in kritisch affirmativem Gestus, so liest sich die Arte Povera wie eine Befreiung ‚dynamischer Materialität’ aus dem Korsett des Warenfetischs. Doch die künstlerische Auseinandersetzung mit zirkulierenden Dingen und fluktuierenden Materialitäten endet hier noch längst nicht. Dass es sich um ein epochenübergreifendes Projekt des 20. Jahrhunderts handelt, darauf deutet auch die Publikation „Formless. A User’s Guide“ hin: Zum Jahrtausendende reaktivieren Rosalind Krauss und Yves-Alain Bois Georges Batailles Ästhetik des ‚Formlosen‘ – und systematisieren sie als Schlüssel für die Kunst der Moderne und Postmoderne. Einerseits bildet das Formlose einen Zugriff auf Müll, dingliche Entdifferenzierung und Entropie, andererseits verwischt es die Grenzen zwischen dinglicher und körperlicher (‚abjekter‘) Materialität. Von Körper-Dingen und Ding-Körpern wiederum ist es nicht weit zum Thema der Prothesen und Cyborgs (Butler, Haraway)… Somit im ‚Post Human Discourse’ angelangt, wenden wir uns im letzten Teil des Seminars Ökosystemen und Petrischalen zu (Bennett, Latour, Morton) – und werden feststellen, dass es gar nicht so einfach ist zu erkennen, wo ein Ding aufhört, und das nächste beginnt.
How to Make Sense of an Empty Gallery Space
Some art seems to behave like Lewis Carroll’s Cheshire cat: it dissolves away until nothing is left but a grin. Is the joke on us? For those of us unaware of its intentions, the dematerializing operations of Conceptual Art can easily appear like some elitist insider game. However, an (almost) empty gallery space is not necessarily just a provocation, but can mean many different things: Manipulations of the ‘white cube’ can mean that art has turned against itself, dissecting its institutional and spatial frameworks. An empty gallery space can be symptomatic for a form of art that has moved away from modernism’s auratic objects/commodities – exploring, instead, ideas, actions and participation as new ‘materials’ for art. Or it can mean that art has simply left the museum and is ‘taking place’ as an ephemeral intervention in public space. The art historical key to understanding the subversive potentials of an empty gallery space lies in the 1960s, when Conceptual Art, Institutional Critique and Fluxus emerged. This seminar sets out to unpack this history in order to understand its more recent legacy: Francis Alys pushing a block of ice through Mexico City, Rirkrit Tiravanija turning museums into Thai food canteens, or Adrian Piper making her audience sign ethical contracts with themselves.
Sur-real
Seit einigen Jahrzehnten erlebt der Surrealismus eine nicht enden wollende Renaissance. Dieses Seminar soll das, was im Paris der 1920er im Kreise einiger Literaten entstand, auf jene ästhetischen Konzepte, medialen Strategien, Diskurse und ‚Sites’ hin untersuchen, die in der Kunst unserer Gegenwart ein Fortleben führen. Der Anspruch des Sur-Realismus, in unsere Alltagserfahrung einzugreifen, hat bis heute nicht an Relevanz eingebüßt. In diesem Sinne wird es hier nicht (so sehr) um die schmelzenden Uhren Salvador Dalís gehen, sondern vielmehr um Operationen am rohen Material der Wirklichkeit: dokumentarische Formate, autobiographische Romane, idiosynkratische Sammlungen und Fundobjekte, deren Bedeutungspotentiale im Zeichen eines destabilisierten Realitätskonzepts frei zur Disposition standen. Inspiriert von Psychoanalyse und Ethnographie verhandelte der Surrealismus insbesondere Aspekte wie Körperlichkeit und Verdinglichung, Heimsuchung und fetischistische Animation. Ausgehend von den innovativen Surrealismus-Rezeptionen der letzten 30 Jahre wird unser Seminar Schlüsselmotive der Surrealismus ausmachen, um sie für ein Verständnis der Kunstproduktion der Moderne und Gegenwart zu erschließen.
How to Write about Contemporary Art
Selbige Frage war Titel eines 2014 erschienen Ratgebers der Londoner Kunstkritikerin Gilda Williams. Die Antwort jedoch, so lernen wir schon in der Einleitung, liegt irgendwo zwischen den spröden Konventionen des “International Art English” und dem Erarbeiten einer eigenen Stimme, Methodik und nicht zuletzt eines Ethos des kritischen Schreibens. Dabei gilt es, das Ich des Autors oder der Autorin irgendwo zwischen den Polen “Confessional Writing” und “objektiver Kritik” – zwischen “Kunst” und “Wissenschaft” – zu stabilisieren. In diesem Praxisseminar werden wir die einschlägigen Textsorten kunstkritischen Schreibens auf ihre Machart hin untersuchen und uns schreibend aneignen. Begleitend zu dieser Praxis werden wir Ratgeber lesen und die Standpunkte methodenkritischer Theoretikerinnen kennenlernen und diskutieren. Autorinnen einschlägiger Magazine (Frieze, Artfoum) werden uns darüber hinaus ungefilterte Einblicke in die Realität des professionalisierten Schreibens geben.
Post-Internet. Ein Gegenwartstrend im Kontext der Medienkunst-Geschichte
Der Begriff „Post-Internet“ hat Konjunktur: Er spukt durch Feuilletons, durch Ausstellungs-Pressetexte und wird auf dem Kunstmarkt als neuester Trend hoch gehandelt. Mit dem diffusen Label „Post-Internet“ wird derzeit nicht nur eine neue Generation von Medienkünstlern (Stichwort ‚digital natives’) gefeiert, sondern geradezu ein Paradigmenwechsel in der zeitgenössischen Kunstproduktion beschworen. Eine Ausstellungsankündigung des Jahres 2014 erläutert den neuen Begriff wie folgt: „The most pressing condition underlying contemporary culture today […] may well be the omnipresence of the internet. […] Post-internet refers not to a time ‚after’ the internet, but rather to an internet state of mind – to think in the fashion of the network.“ Internet-Flaneure durchstreifen die 1:1 abfotografierte Welt von Google-Streetview, fördern die obskuren Fantasien des Darknet zu Tage, lassen Kühlschränke singen und die digitalen Puppen tanzen. Tatsächlich ist hat sich das Internet in den letzten 15 Jahren zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bereich unseres Alltagslebens entwickelt. „Post-Internet“ – ein Modewort, das uns alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen will? Wir gehen dem Trend auf den Grund indem wir seine historischen Voraussetzungen erarbeiten. Unser Weg führt von der Gegenwart in die Vergangenheit – und zurück: Wir betrachten die brandaktuelle künstlerische Hervorbringungen, rollen dann die Geschichte der Medienkunst vor uns auf, lernen ihre wichtigsten historischen Vertreter kennen, erarbeiten von dort aus die kunsthistorischen Voraussetzungen der Medienkunst, lesen einschlägige theoretische Texte, um daraufhin den Bogen zurück zu schlagen und unser Wissen auf eine Auswahl jener KünstlerInnen anzuwenden, die mit dem neuen Begriff assoziiert werden (u.a. Ed Atkins, Kate Cooper, Cecil B. Evans, Mark Leckey, Jon Rafman, Hito Steyerl, Ryan Trekartin).